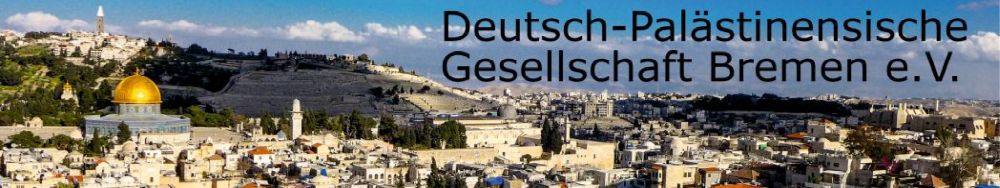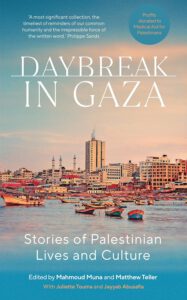„Daybreak in Gaza: Stories of Palestinian Lives and Culture“, herausgegeben von Mahmoud Muna und Matthew Teller mit Juliette Touma und Jayyab Abusafia, Saqi Books, 2024.
Heutzutage wird über Gaza meist in Zahlen gesprochen: wie viele Tote, wie viele Vertriebene, wie viele Gebäude aus der Landschaft verschwunden sind. Doch die Geschichten, Lieder, Rezepte und Erinnerungen, die über Generationen weitergegeben wurden – alles, was Gaza zu einem Ort voller Geschichte, Widerstandskraft und einem unerschütterlichen Beharren auf dem Leben macht – bleiben allzu oft ungehört.
„ Daybreak in Gaza: Geschichten aus dem Leben und der Kultur der Palästinenser “, eine Sammlung von Vignetten verschiedenster palästinensischer Stimmen, versucht, die Seite der Enklave ans Licht zu bringen und zu bewahren, die in den Nachrichten selten zu sehen ist. Das Buch erscheint im September 2024 bei Saqi Books, der Erlös geht an die NGO Medical Aid for Palestinians. Es bietet einen tieferen Einblick in das Leben während des Völkermords: Künstler, die zwischen den Bombenangriffen skizzieren, Köche, die aus dem Exil die Aromen der Heimat nachkochen, Sanitäter, die sich um die Verwundeten kümmern und gleichzeitig an ihren Träumen von einer Zukunft nach dem Krieg festhalten, und Journalisten, die alles riskieren, um die Geschichte ihres Volkes zu erzählen.
Diese miteinander verwobenen Erzählungen weisen die engen Etiketten von Opferrolle und Überleben zurück, die Gaza so oft von außen aufgezwungen werden. Durch die persönlichen Reflexionen der Autoren, von denen viele Verlust und Vertreibung selbst erlebt haben, offenbart das Buch den kollektiven Geist eines Volkes, das entschlossen ist zu leben, zu schaffen und zu erinnern.
Für Mahmoud Muna, einen in Jerusalem lebenden palästinensischen Schriftsteller, Verleger, Buchhändler und einen der Herausgeber des Buches, war „Daybreak in Gaza“ mehr als ein literarisches Projekt. „Ich war nie dort, aber wie viele Palästinenser habe ich Gaza immer in mir getragen“, sagte er gegenüber +972. „Seine Geschichten haben unser kollektives Bewusstsein geprägt.“
[…]
Letzten Monat durchsuchte die israelische Polizei Munas Buchladen „Educational Bookshop“ in Jerusalem. Sie verhafteten ihn und seinen Neffen Ahmad über Nacht wegen des Verdachts der „Störung der öffentlichen Ordnung“ und beschlagnahmten eine Reihe von Büchern, die ihrer Meinung nach „Volksverhetzung“ darstellten. Der Laden ist seit langem für seine Förderung palästinensischer Literatur und palästinensischer Denkweise bekannt. Die israelische Razzia – die Anfang dieser Woche wiederholt wurde, diesmal mit der Festnahme von Munas Bruder Imad – unterstrich nur die Repression, die „Daybreak in Gaza“ offenlegen will. Munas Engagement für das Geschichtenerzählen und den Widerstand ist jedoch ungebrochen.
Ein dringender moralischer Imperativ
Wie seine Mitherausgeber beschrieb Muna die Erschöpfung, die das Eintauchen in Geschichten über Verlust, Überleben und Widerstandskraft mit sich bringt – was, insbesondere als Palästinenser, eine außergewöhnliche emotionale und intellektuelle Bandbreite erfordert. „Es gab Momente, in denen ich mich tagelang zurückziehen musste, um mich intensiv mit jeder Geschichte auseinandersetzen zu können, ohne überwältigt zu werden“, gab er zu.
Eine weitere Schwierigkeit beim Lektorat bestand darin, „sicherzustellen, dass das Buch nicht nur eine weitere Sammlung tragischer Geschichten bleibt“. Schmerz und Verlust seien bei der Auseinandersetzung mit einem solchen Thema zwar unbestreitbar, doch „Gaza ist so viel mehr als das“, bemerkte er. Ohne die Poesie, die Musik, den Humor und die Widerstandsfähigkeit seiner Menschen „wäre die Geschichte Gazas unvollständig.“
Muna erklärte, ein Leitprinzip bei der Entstehung des Buches – basierend auf Edward Saids Philosophie der Wiedererlangung von Erzählungen – sei, dass jeder, der die Schrecken der letzten 17 Monate erlebt hat, mehr als qualifiziert sei, seine eigene Geschichte zu erzählen. „Autoren schreiben Geschichten, aber sie unterstützen auch andere Autoren und geben ihnen Gehör – und genau das wollten wir erreichen“, sagte er. „Wir wollten sicherstellen, dass sie selbst über ihre Erfahrungen berichten.“
Da es kein „Chicago Manual of Style“ gab, das das Verfassen eines Kriegstagebuchs über einen Völkermord beschreibt, bemerkte Muna, und er und seine Mitherausgeber sich nur an ihrem moralischen Kompass und der Dringlichkeit des Augenblicks orientierten, strebten sie nicht nach literarischer Perfektion. „Es geht um den Inhalt: die rohen, ungefilterten Geschichten selbst“, erklärte er und wies darauf hin, dass viele der Beiträge unter erschütternden Bedingungen entstanden seien, mit Menschen, die von Trauer und Trauma überwältigt seien. „Hätten wir zu viel Zeit damit verbracht, jede Entscheidung zu hinterfragen – uns zu fragen: ‚Mache ich das richtig?‘ –, wäre nie etwas fertig geworden.“
Munas Haupt-Co-Herausgeber war Matthew Teller, ein in Großbritannien lebender Autor und Rundfunksprecher, der sich seit langem auf Palästina und den Nahen Osten konzentriert. Für ihn war die Arbeit an „Daybreak in Gaza“ eine moralische Verpflichtung. „Zwischen Oktober und Dezember 2023 verfolgte ich die Nachrichten bequem und sicher von meinem Zuhause in Großbritannien aus“, erzählte er. „Was ich sah, war entsetzlich. Ich protestierte auf der Straße, ich schrieb, ich hielt Vorträge – aber nichts davon fühlte sich ausreichend an.“Was Teller jedoch am meisten beeindruckte, war das Schweigen seiner eigenen Branche. Er hatte erwartet, dass Verlage, große Medien und Literaten dringlich auf den Völkermord reagieren würden. „Ich habe immer auf etwas gewartet, auf eine Bewegung, eine ehrenhafte, moralische Antwort, aber nichts kam“, sagte er. „Es gab nur wenige Stimmen, die sich zu Wort meldeten.“
Das Buch sollte ursprünglich viel kürzer sein, erklärte er. „Anfangs war ich mir nicht sicher, ob wir die Menschen in Gaza überhaupt erreichen würden, geschweige denn, ob sie uns genug vertrauen würden, um ihre Erfahrungen unter Bombardierung zu teilen.“ Doch im Laufe des Prozesses und mit der zunehmenden Anzahl von Zeugenaussagen aus Gaza, die die Herausgeber erreichten, erweiterte sich der Umfang des Buches.
„Wir hofften, dass das Buch bis zu seiner Veröffentlichung obsolet sein würde“, fuhr Teller fort. Doch angesichts des anhaltenden Völkermords und des anhaltenden Leids wurde das Buch zu einem ständigen Aufruf zum Handeln. „Das Ziel war einfach, zu handeln – nicht die Empörung in sich hineinzufressen oder einfach etwas auf Instagram zu posten und weiterzumachen, sondern bewusste, konkrete Maßnahmen in der Welt zu ergreifen.“
Diese Dringlichkeit spiegelte sich auch in der Entscheidung wider, das Buch zunächst auf Englisch zu veröffentlichen. Das Team konnte es sich nicht leisten, Jahre damit zu verbringen, die Geschichten zu verfeinern, zu verfeinern und in mehrere Sprachen zu übersetzen. „Unsere Priorität war es, so schnell wie möglich ein möglichst breites globales Publikum zu erreichen“, erklärte Teller.
„Was denken die Menschen in Gaza? Sprechen Sie mit ihnen.“
Bei der Arbeit an seinem Buch achtete Teller darauf, die Zeugenaussagen nicht in ein bestimmtes Narrativ zu pressen. „Für mich als jemanden, der von außerhalb kommt, kein Palästinenser ist und aus sicherer Entfernung spricht, war es entscheidend, die Situation nicht zu verschleiern“, sagte Teller. „Es versucht nicht, das ganze Grauen dessen zu erklären oder zu erfassen, was geschehen ist und weiterhin geschieht. Es ist lediglich ein Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen.“
Die Autoren, fuhr er fort, „waren sich völlig im Klaren darüber, dass dies keine Trauerrede für Gaza sein sollte.“ Vor diesem Hintergrund griffen die Herausgeber auf zwei zentrale Ideen der palästinensischen Literatur zurück: die Überzeugung des Dichters Mahmoud Darwish, dass Hoffnung gepflegt, genährt und wachsen gelassen werden muss, und Edward Saids Argument, dass Hoffnungslosigkeit eine Form der Unterwerfung sei.
Für Palästinenser, insbesondere im Gazastreifen, ist Hoffnung kein Luxus – sie ist eine Notwendigkeit zum Überleben. Teller bemerkte, dass das Team diese Botschaft über das Buch hinaus vermittelte und direkt mit Lesern in Großbritannien und Europa in Kontakt trat, um der weit verbreiteten Resignation entgegenzutreten, die den internationalen Diskurs über Palästina oft prägt.
Am auffälligsten ist vielleicht, dass das Buch die Palästinenser weder als Schurken noch als übermenschliche Symbole der Widerstandsfähigkeit darstellt. „Es gibt ein vorherrschendes Narrativ – insbesondere im Westen und in Israel –, das jeden Palästinenser in Gaza als Terroristen darstellen will“, sagte Teller. „Aber es gibt auch ein anderes, ebenso entmenschlichendes Narrativ: die Vorstellung, die Palästinenser in Gaza seien Superhelden, die alles ertragen könnten und deren Widerstandsfähigkeit grenzenlos sei.“ Die Zeugenaussagen in „Daybreak in Gaza“ widersetzen sich beiden Extremen und bekräftigen die einfache, aber entscheidende Wahrheit: Palästinenser sind ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut. Werfen Sie eine Bombe auf uns, und wir werden getötet.
Das Ziel des Buches, so Teller, sei nicht, den Menschen in Gaza „eine Stimme zu geben“. „Sie haben bereits eine Stimme“, behauptete er, „stark, eindringlich und unerschütterlich. Sie haben geschrien, gebrüllt und gebrüllt, damit die Welt ihnen zuhört. Das Problem ist, dass wir nicht aufgepasst haben.“
Muna schloss sich dieser Meinung an und beschrieb das Buch als einen Aufruf, mehr Stimmen zu Wort kommen zu lassen und mehr Geschichten zu erzählen. „Während unserer Lesereisen wurden wir oft gefragt: ‚Was denken die Menschen in Gaza? Was sagen sie?‘“, erklärte er. „Unsere Antwort ist einfach: Sprechen Sie mit ihnen.“
Für Juliette Touma, die als Kommunikationsdirektorin des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) jahrelang eng mit palästinensischen Flüchtlingen in der Region zusammengearbeitet hat, ist Gaza keine abstrakte Realität; es ist ein Ort, der sie mit offenen Armen empfangen hat. Sie erinnert sich nicht nur an ein Kriegsgebiet, sondern an eine lebendige Gemeinde voller Buchhandlungen, Lachen, Kunst und hervorragendem Essen. „Trotz der erdrückenden 18-jährigen Blockade haben die Menschen in Gaza das Leben weiter angenommen“, sagte sie gegenüber +972.
Touma – die zusammen mit dem in London lebenden Journalisten Jayyab Abusafia aus dem Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen Muna und Teller bei der Zusammenstellung der Vignetten unterstützte – „Daybreak in Gaza“ sei ein wichtiger Gegenentwurf zur Entmenschlichung der Menschen im Gazastreifen, „von denen viele enge Freunde, Kollegen oder Bekannte sind“, sagte sie. „Das Ausmaß der Entmenschlichung, die sie ertragen mussten, war mehr als schockierend.“
Quelle: +972 Magazin v. 13.03.2025 (automatische Übersetzung; dort der vollständige Artikel)